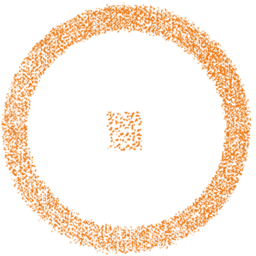Sprache zwischen Wahrnehmung, Intuition und Interpretation - der Aufsteller als Übersetzer
Veröffentlicht in „Praxis der Systemaufstellung“, Oktober 2010
„Ein groβer Daimon steht zwischen Gott und den Sterblichen. Und welche ist seine Aufgabe? Er deutet und vermittelt den Göttern die Dinge, die von den Menschen kommen, und den Menschen die Dinge, die von den Göttern kommen. (...) Zwischen ihnen wird er zum Ergänzer und Mittler. Denn Gott verkehrt nicht direkt mit den Menschen; aller Umgang und das Gespräch zwischen Göttern und Menschen bedarf eines Mittlers. Wer sich auf diese Kunst versteht, ist ein dämonischer Mensch, einfallsreich und über das gewöhnliche und alltägliche Maβ hinaus begabt.“ (Platon, Symposion)[1]
In diesem Artikel möchte ich die Gedanken kreisen lassen um die Sprache, um ihre Bedeutung und Verwendung als zentrales Element in der Aufstellungsarbeit, das Brücken schlagen oder Hindernisse errichten kann auf dem Weg, den ein Klient beschreitet, und um die Funktion des Aufstellers als Daimon, als Mittler zwischen den verschiedenen Ebenen des Bewusstseins.
Die verschiedenen Ebenen der Sprache
Wenn ich hier von Sprache spreche, so meine ich jede Art von Zeichen, mit denen wir unsere Wirklichkeit zu erfassen, und sie für uns selbst und für andere verständlich zu machen suchen .
In unserer Arbeit als Aufsteller haben wir es zum einen mit der Sprache der ausgesprochenen Worte zu tun, wenn ein Klient uns sein Anliegen formuliert, wir Fragen stellen, er seine Umstände beschreibt und konkrete Daten aus seiner Biografie und Familiengeschichte einbringt. Das wäre die explizite Ebene der Sprache, das was wir bewusst transportieren.
Gleichzeitig flieβt aber eine ungeheure Menge an Information auf der impliziten, unterbewussten Ebene, wenn über die Sprache des Körpers Gedanken, Zustände und Gefühle ausgedrückt werden, sowohl von seiten des Klienten wie des Therapeuten, der Stellvertreter und alles anderen anwesenden Teilnehmer einer Gruppe.
Und dann haben wir es beim Aufstellen auch noch mit der Sprache des Raumes zu tun, die auf Grund der Anordnung der Stellvertreter Auskunft gibt über Bindungsmuster, über die Qualität von Beziehungen, über Ordnung oder Unordnung, über stärkende oder krank machende Plätze in einem System, über fehlende Mitglieder, Entscheidungstendenzen Einzelner und vieles mehr.
Diese Raumbilder zeigen uns nicht nur, wie der Klient sich in seinem System bewusst erlebt (v.a. wenn er selbst die Stellvertreter plaziert), sie dienen auch dazu, unterbewusste und unbewusste Inhalte aus der Psyche der Klienten und aus dem Beziehungsnetz ihrer Familien ans Licht zu bringen. Auf dieser Ebene der Aufstellung bedient sich das Unbewusste sozusagen der Stellvertreter, um über sie auf Vergessenes, Verdrängtes, Anstehendes hinzuweisen. Und es tut dies mit der ihm eigenen Sprache, in Form von symbolischen Bildern.
Für gewöhnlich kennen wir die symbolische Sprache des Unbewussten aus unseren Träumen oder auch aus der Poesie, wo wir es gewohnt sind, uns von Metaphern und Analogien berühren und bewegen zu lassen.
Von daher wissen wir auch um die Schwierigkeit, diese Erfahrungen in Worte zu fassen, da ihr Inhalt weit über die verbalen Begriffe hinaus geht. In diesem Sinne erscheint mir die Aufgabe des Aufstellers eng verwandt der eines Übersetzers, der, um als Mittler der Seelensprache treu zu bleiben, die Worte, die er diesen Bildern sozusagen als Untertitel hinzufügt, sorgsam wählen muss.
Ich möchte dazu ein konkretes Beispiel anführen.
In letzter Zeit hatte ich mehrmals Klientinnen in der Beratung, die mir beim Erstellen des Genogramms auf die Frage nach Geschwistern sagten: „Ich hätte noch mehrere Geschwister, aber die sind nicht zur Welt gekommen.“ Und wenn ich dann weiter nach den genaueren Umständen fragte und von wem sie diese Information denn erhalten hätten, erfuhr ich: „Es kam bei einer Aufstellung ans Licht, dass meine Mutter mehrmals abgetrieben hat.“
In solchen Situationen frage ich mich, was bei dieser Aufstellung als konkretes Raumbild wahrnehmbar war, was der Therapeut intuitiv erfasst hat und wie diese Wahrnehmungen dann interpetiert, d.h. in Worte übersetzt wurde, um bei der Klientin eine derartige Überzeugung hervorzurufen.
Wahrnehmen und Benennen
Bei einer Aufstellung kann ich z.B. sehen, dass der Blick der Stellvertreterin der Mutter der Klientin zum Boden gerichtet ist.
Diese Tatsache kann natürlich Verschiedenes ausdrücken: Trauer, Scham, Ablehnung, Todessehnsucht, den Versuch, etwas zu verheimlichen etc. Wenn sich z.B. der Eindruck der Trauer verfestigt, so kann ich eine andere Person bitten, sich vor der Mutter auf den Boden zu legen, um zu beobachten, wie sich die Bewegungen in der Aufstellung weiterentwickeln. Wenn nun diese neue Stellvertreterin beginnt sich zusammen zu rollen, mag das Bild eines Kindes im Mutterleib oder eines Neugeborenen als Assoziation auftauchen.
Was ich über meine fünf Sinne bewusst wahrnehmen kann, ist die Körperhaltung der Stellvertreter, ihr Gesichtsausdruck, ihre Bewegungen, der Tonfall ihrer Stimme, der Rhythmus ihrer Atmung usw. Wenn es mir darüber hinaus gelingt, unbefangen präsent zu sein, mich dem Geschehen in der Aufstellung schlicht auszusetzen, so kann auch die Intuition ins Spiel kommen, jene Fähigkeit, die nach C.G. Jung „die Wahrnehmung auf unbewusstem Weg vermittelt“. Diese unbewusste Wahrnehmung äuβert sich in symbolischer Form, in Bildern, Empfindungen, Eindrücken, die in uns auftauchen und erst durch die Übertragung in Worte für unser Bewusstsein fassbar werden. So entstehen Assoziationen: neue Wahrnehmungen werden mit alten, bekannten Erfahrungen vernetzt und können so benannt und eingeordnet werden.
Genau an diesem Punkt kommt dem Aufsteller nun die heikle Aufgabe eines Sprachmittlers zu, der versucht, mit seinen Worten eine Brücke zu schlagen zwischen verschiedenen Welten und deren Sprache, in diesem Fall zwischen dem Unbewussten und dem Bewussten, zwischen der Wahrnehmung des Klienten und seiner eigenen.
Wenn wir davon ausgehen, dass Übersetzen stets ein unvollkommenes Unterfangen ist, dass wir dabei, wie Umberto Eco es in einem seiner letzten Bücher so treffend formuliert, immer nur fast dasselbe sagen können, so kann uns diese Erkenntnis auch bei unserer Arbeit als Aufsteller zu Feingefühl und Umsicht verhelfen.
Was Worte bewegen
Das würde also bedeuten, ein ums andere Mal inne zu halten, um uns die Wirkung unserer Worte bewusst zu machen. Es würde bedeuten, unsere Interventionen daraufhin zu überprüfen, welche der möglichen Aussagen der Klientin und ihrem System hilfreich sein können und den meisten Handlungsspielraum eröffnen.
Was geschieht, wenn ich als Aufstellungsleiterin vorerst nur einmal meine Assoziation innerlich zur Kenntnis nehme, und dann die Klientin frage, wie es ihr geht, wenn sie dieses Bild sieht?
Was geschieht, wenn ich sage: „Wenn ich das sehe, kommt bei mir das Bild eines ganz kleinen Kindes, das da vor der Mutter liegt. Hat deine Mutter eigene Kinder oder Geschwister verloren? Gab es vielleicht weiter zurück in der Familie Frauen, die Kinder verloren haben?“
Und wenn in diesem Moment keine schlüssige Auskunft kommt, dies einfach achte und darauf verzichte, „Wahrheiten“ in Form von kategorischen Feststellungen in die Welt zu setzen.
Sätze wie: „Hier liegt ein totes Kind. Deine Mutter hat abgetrieben.“, mögen in ihrer Bestimmtheit beeindruckend klingen. Wir sollten aber bedenken, was diese Worte in der Klientin auslösen können und was in einem System geschieht, wenn von auβen diese Art von Information als Tatsache eingepflanzt wird.
Wie verändert sich dadurch die Beziehung der Klientin zur Mutter? Macht es ihr eine solche Feststellung leichter, sich der Mutter zu nähern, sie als Ressource in ihrem Leben zu spüren, sich zu freuen, dass gerade diese Frau ihre Mutter und sie ihre Tochter ist? Oder wird eine solche Interpretation nicht vielmehr zu einem Urteil, das sich zwischen ihnen einnistet und die Tochter verleitet, sich über die Mutter zu stellen? Wem schenkt die Klientin mehr Glauben, dem Aufsteller, der Familiengeheimnisse enthüllt, oder der Mutter, die versichert, dass sie werder Fehlgeburten hatte noch je abgetrieben hat?
Wirklichkeit oder Wahrheit?
Interpretation hat mit der Übertragung des Wahrgenommenen in deutende Worte zu tun. Und dabei entfernen wir uns leicht von der Wirklichkeit als dem, was wirkt, um uns auf eine Wahrheit zu konzentrieren, auf etwas, das nur richtig oder falsch sein kann und uns dadurch das trügerische Gefühl von Sicherheit vermittelt.
Wenn ich als Aufstellerin den symbolischen Ausdruck des Unbewussten – in diesem Fall das Bild der Stellvertrerin einer Mutter, die auf eine andere Person blickt, die sich auf dem Boden zusammenrollt – wortwörtlich nehme, so gibt es nur eine einzige Art des Verständnisses: die Mutter hat ein Kind verloren oder abgetrieben. Wenn ich hingegen das Unbewusste und seine Sprache achte, so kann ich das auftauchende Bild auch als Widerhall eines Themas deuten, das vielerorts in der Familie präsent sein und seine Spuren hinterlassen haben mag: Frauen haben auf schmerzliche Art Kinder verloren und die Trauer ist immer noch da.
Was bewegt sich in der Seele einer Klientin, wenn sie solche Worte hört? Und wo führt sie diese Bewegung hin?
Was bewegt sich in mir als Aufstellerin, wenn ich dem, was offen bleibt, vertraue, anstatt es dingfest machen zu wollen? Wenn ich meine Sprache in seinen Dienst stelle? Wo führt mich diese Bewegung hin?
[1] Der Daimon erscheint bei Platon als ein zwar der göttlichen Sphäre angehöriges, aber nicht eigentlich göttliches Wesen. Das Schicksal kann gut oder schlecht sein, die vom Daimon verkörperte Schicksalsbestimmung wird aber als zum Guten gerichtet gesehen, ähnlich dem Schutzengel im Christentum.