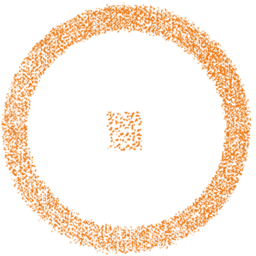Das Glück eines Kindes beginnt im Herzen seiner Eltern
Veröffentlicht in der spanischen Zeitschrift „Vivir en familia“ im Sommer 2013
„Unsere Kinder sollen glücklich und gesund aufwachsen!” – das ist wohl der größte Wunsch jeder Mutter und jedes Vaters vom ersten Augenblick des Lebens ihres Kindes an: die körperliche und psychische Gesundheit, das materielle und emotionale Wohlergehen dieses kleinen Wesens, das sie auf die Welt gebracht haben. Aus diesem Grund verwenden angehende Mütter viel Aufmerksamkeit darauf, sich gesund und fit zu erhalten, sie achten auf richtige Ernährung, ausreichend Schlaf und Bewegung, die entsprechenden medizinischen Kontrollen und bereiten sich so auf die Geburt und die Stillzeit vor. Genauso verwenden beide Eltern für gewöhnlich viel Zeit und Mühe darauf, das Heim für die Ankunft des Kindes vorzubereiten. Sie schaffen Platz, dekorieren, passen die räumlichen Gegebenheiten an die besonderen Bedürfnisse eines Babys an.
Während sie sich um alle diese notwendigen materiellen Details kümmern, schweifen ihre Gedanken auch immer wieder in die Zukunft, in die Zeit unmittelbar nach der Geburt, wenn sie ihre Tochter oder ihren Sohn endlich kennen lernen, wenn sie ihn sehen, hören und berühren können und jeden Tag aufs Neue über sein Wachsen staunen werden. Wie wird er sein? Was wird sie brauchen? Werden wir sie verstehen und ihre Bedürfnisse erfüllen können? Was werden wir wohl tun müssen, um ihn lachen zu sehen und zu wissen, dass es ihm an nichts fehlt? Wie kann ich die gute Mutter oder der gute Vater sein, der ich so gerne sein möchte?
Und neben all diesen vorfreudigen Fragen tauchen so manches Mal auch andere, mehr oder weniger bewusste, mehr oder weniger beunruhigende Gedanken auf: Wie kann ich bestimmte Muster und Gewohnheiten meiner Herkunftsfamilie ablegen? ... Wie kann ich meinem Kind ein besseres Beispiel sein als meine Eltern es waren? ... Wie wird das Verhältnis zur Schwiegerfamilie ab jetzt sein? ... Werden sich die Fehler und Irrtümer wiederholen? ... Welche Beziehung wird unsere Tochter zu ihren Halbgeschwistern haben? ... Wie kann ich ihr eine glücklichere Kindheit bieten als es meine war? ... Wie können wir sie vor der Last der Vergangenheit bewahren? ...
Diese und viele andere ungelöste Themen, wohl verwahrte Bilder und Gefühle drängen genau jetzt an die Oberfläche angesichts der bevorstehenden Veränderung, von der beide Eltern ahnen, dass sie tief greifend und endgültig sein wird. Es ist, als ob das Kind den Erwachsenen schon vor der Geburt als Spiegel dient und ihnen so hilft, sich ihrer eigenen Geschichte bewusst zu werden, ihrer Ängste, Defizite, Wünsche und auch der anstehenden Aufgaben.
Wann immer solche Signale auftauchen, haben Eltern grundsätzlich zwei Möglichkeiten: entweder sie verdrängen diese Gedanken möglichst rasch wieder und versuchen, weiter so zu funktionieren wie bisher, oder sie nutzen die Gelegenheit, die sich ihnen bietet, um auch den seelischen Raum für ihr Kind vorzubereiten.
Die Bedeutung eines sicheren emotionalen Raums
Um uns vor Augen zu führen, wie wichtig für ein Kind das emotionale Umfeld seiner Familie ist, genügt es, uns kurz in die Situation eines Neugeborenen zu versetzen: ein kleines, wehrloses Wesen, das voll und ganz von seinem Umfeld abhängt, von den Erwachsenen in seiner Umgebung. Nur sie garantieren ihm die Nahrung und Pflege, die es für sein Wachstum benötigt. Und eben sie sind es auch, die ihm Zuwendung, Aufmerksamkeit und Körperkontakt bieten müssen, damit es sich gesund entwickeln kann. Somit ist die sichere Bindung an die Erwachsenen das Wichtigste und Vorrangigste für das Kind, zu wissen, dass sie zur Verfügung stehen und dass die Zugehörigkeit zur Gruppe – und damit das Überleben – gesichert sind.
Diese Erfahrung, die sich einstellt, lange bevor ein Kind sie in Worte fassen kann, gräbt sich tief ins Unterbewusstsein ein und bestimmt sein Verhalten von den ersten Momenten des Lebens an. Um sich die Aufmerksamkeit und Fürsorge der Mutter, des Vaters oder anderer erwachsener Bezugspersonen zu sichern, lernt ein Baby sehr schnell, seine Umgebung zu beobachten und die leisesten Signale zu erfassen. Es nimmt den Rhythmus und Tonfall der Stimmen wahr oder die Stille, die sich in manchen Momenten ausbreitet, die Wärme der Haut, die es berührt, oder die Kälte der Einsamkeit, das süße Aroma der Milch oder den sauren Geruch der Angst, den ruhigen und liebevollen Blick der Mutter oder ihren angespannten und abwesenden Gesichtsausdruck. Mit allen Sinnen registriert es auch das, was zwischen den Menschen geschieht, ihre Beziehungen und ihre Kommunikation, jene unsichtbaren Fäden, die die verschiedenen Mitglieder der Familie miteinander verbinden und ihre Gefühle und Stimmungen in hohem Maße bestimmen.
Auf diese Art und Weise wird jedes Kind zu einem wahren Experten für Körpersprache, für jene 90 Prozent der menschlichen Kommunikation, die jenseits der Worte erfolgen. So kann die Information, die es erhält, das Kind entweder beruhigen und ihm sagen, dass in seiner Welt alles in Ordnung ist, oder Unruhe und Alarmbereitschaft auslösen, welche sich dann in einer ganzen Reihe von Reaktionen zeigen. Diese Antworten auf die gefühlte Bedrohung drücken zum einen die ängstliche Sorge des Kindes aus, zum anderen zeigen sie aber auch, wie dieser kleine Mensch versucht, für die Großen Fehlendes auszugleichen und Bedürfnisse zu erfüllen.
Vielleicht fragen sich jetzt einige, wie in diesem Zusammenhang das Erfüllen von Bedürfnissen zu verstehen ist, wie denn ein kleines Kind Aufgaben für Erwachsene übernehmen kann.
Die ursprüngliche Liebe des Kindes zu seinen Eltern
Tatsächlich übernehmen Kinder bereits sehr früh und auf ganz unbewusste Art und Weise Aufgaben im System, ja in bestimmten Situationen können wir sogar sagen, sie „opfern“ sich für das Wohl ihrer Familie. Das heißt, aus ihrer totalen Abhängigkeit und Bedürftigkeit heraus handeln sie mit bedingungsloser Hingabe, ohne Rücksicht auf die Folgen, die dieses Verhalten für ihr eigenes Leben und Wohlergehen haben mag.
Aus der großen Anzahl von möglichen Dynamiken seien hier nur einige wenige angeführt:
Eine Tochter übernimmt bereitwillig und ohne es zu hinterfragen die Rolle der Mutter der Mutter, wenn dieser die nährende Beziehung zu ihrer eigenen Mutter gefehlt hat. Das Mädchen sorgt sich um ihre Mutter und kümmert sich auf seine Art um sie, stützt und verwöhnt sie, zeigt sich liebevoll auf der einen Seite und fordernd, überlegen und dominant in anderen Momenten.
Ein anderes Mal ist es ein Sohn, der in Bresche springt, um die Leere in der Paarbeziehung seiner Eltern auszufüllen: zum einen ersetzt er den Mann an der Seite der Mutter und bietet ihr jene emotionale Wärme, die sie von ihrem Mann nicht bekommt; zum anderen gerät der Junge in dieser Rolle unvermeidlich in einen rivalisierenden Konflikt mit dem Vater und dient so als „Blitzableiter“ für viele angestaute Spannungen.
Genauso kann ein Mädchen bereits sehr früh eine besondere Nähe zum Vater entwickeln und sich auf der anderen Seite distanziert, ja sogar feindselig der Mutter gegenüber verhalten. Neben der bereits zuvor erwähnten Dynamik wäre hier ein anderer möglicher Hintergrund eine frühere Paarbeziehung, in diesem Fall des Vaters, die in der aktuellen Familie nicht geachtet oder vielleicht sogar gering geschätzt wird. In diesem Fall kann eine Tochter leicht zur Stellvertreterin dieser ausgegrenzten Frau werden und so das System dazu bringen, sie zu erinnern. Doch auch hier mit einer Hartnäckigkeit, die den Preis, den das Mädchen als Tochter dafür bezahlt, völlig außer Acht lässt.
In anderen Fällen befinden sich beide Eltern noch in einem Trauerprozess um ein Kind, das sie früh verloren haben, sei es während der Schwangerschaft oder rund um die Geburt. Das Kind, das danach zur Welt kommt, nimmt über unendlich viele kleine Zeichen die Trauer und den Schmerz der Eltern wahr, obwohl an der Oberfläche keiner von beiden seine Gefühle zeigt oder davon spricht. Auch hier wird das Kind instinktiv versuchen zu helfen. Das sind entweder jene überschwänglich liebevollen Kinder, “der Sonnenschein der Familie” und später dann fleißige Schüler und Studenten, die alles nur Mögliche unternehmen, um die dunklen Wolken zu vertreiben, die ein ums andere Mal den Blick der Eltern verhängen.
Oder es sind Kinder, deren Verhalten auffällig und schwierig scheint und in keiner Weise als liebevoll interpretiert wird. Bei genauerem Hinsehen jedoch wird schnell klar, dass auch diese Art von Verhalten seine Funktion hat. Es ist, als ob das Kind sagte: “Solange sich ihre Aufmerksamkeit auf mich konzentriert und sie mit mir beschäftigt sind, können sie nicht an ihren Schmerz denken; solange sie mit mir zu kämpfen haben, sind sie vereint.” Denn tatsächlich geschieht es nur allzu oft, dass schmerzliche Verluste Paare trennen, wenn sie es nicht schaffen, ihren Schmerz gemeinsam zu tragen und Hilfe von außen in Anspruch zu nehmen.
Genauso können wir auch Kinder antreffen, die sich extrem ängstlich verhalten, die untröstlich weinen, wenn sie sich auch nur für kurze Zeit von den Eltern trennen sollen, oder sogar mit Erbrechen, Fieber oder anderen Symptomen reagieren, wenn sie zur Schule gehen oder außer Haus übernachten sollen.
Wenn wir wiederum nach der unbewussten Intention hinter dieser Art von Verhalten fragen, so finden wir eine mögliche Antwort in der Sorge des Kindes darum, was zu Hause vorfallen könnte, während es nicht da ist, oder aber auch seine unterbewusste Überzeugung, dass Mama oder Papa, oder beide es „brauchen“.
All diese Beispiele zeigen uns, wie präzise Kinder die Wirklichkeit wahrnehmen, das, was im Vordergrund erscheint, und das, was sich dahinter verbirgt. Und sie zeigen uns auch ihren ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit und Ausgleich im Beziehungsnetz, in dem sie sich bewegen. Da sie noch alle ihre Wahrnehmungskanäle benützen, ohne sie in Frage zu stellen, ihre fünf Sinne und auch ihre Intuition, ist ihr Zugang zur Information viel direkter und spontaner als der unsere, der der Erwachsenen. Und genau aus diesem Grund gibt es Situationen, in denen Kinder unseren vernünftigen und wohlüberlegten Argumenten nicht folgen – sie wissen es einfach besser, im wahrsten Sinne des Wortes.
Was können wir Erwachsenen also tun, um unsere Kinder von jenen Lasten zu befreien, die nicht ihre sind, von jenen unmöglichen Aufträgen, die ihnen lediglich ihre Lebenskraft kosten und es ihnen nicht erlauben, sich dem zu widmen, was wirklich ihre Aufgaben wären: zu wachsen, zu lernen, ihr eigenes Potential zu entfalten?
Die Macht unserer inneren Haltungen
Selbstverständlich gibt es immer wieder Fälle, in denen professionelle Hilfe unerlässlich ist. In vielen anderen Situationen jedoch können Eltern selbst bedeutende Veränderungen im Gefühlszustand oder Verhalten ihrer Kinder erreichen, noch ehe die kritische Grenze überschritten wird. Worum es in erster Linie geht, ist ein Wandel in ihrem eigenen Blick und in ihrer eigenen Haltung. Denn eben weil Kinder vor allem das registrieren, was auf der nonverbalen Ebene kommuniziert wird, nehmen sie all das direkt und unmittelbar auf, was wir auf der subtilen Ebene der Gedanken und Gefühle bewegen.
Wenn wir also die anfangs erwähnten Beispiele hernehmen, würde das bedeuten, dass es den Eltern klar wäre, dass ihre emotionalen Defizite, ihre Bedürfnisse, Konflikte oder Verletzungen eben ausschließlich ihre sind und in die Erwachsenenwelt gehören. Dass Kinder, so liebevoll und hilfsbereit oder unausstehlich und schwierig sie sich auch gebärden mögen, niemals diese Leerräume füllen können. Und dass wir als Erwachsene über die notwendigen persönlichen oder externen Ressourcen verfügen, um unsere Probleme zu lösen.
Es würde bedeuten, unseren Kindern durch, aber vor allem ohne Worte glaubwürdige Botschaften zu vermitteln, die die Ordnung im System klarstellen und es ihnen erlauben, ihren Platz als Kinder, als Kleine einzunehmen und uns als Große zu erleben, auf die sie sich stützen und verlassen können.
Solche Sätze, die wir innerlich sagen können, wären z.B.: “Das, was zwischen Papa und mir los ist, ist unsere Angelegenheit. Mach dir keine Sorgen, wir kümmern uns darum. Und was auch immer geschieht, wir freuen uns, dass wir deine Eltern sind und du unsere Tochter.“
Oder: “Dein Bruder, der vor dir war, ist zu früh gegangen und das hat uns sehr, sehr weh getan. Manchmal wird Mama noch traurig, wenn sie daran denkt, und dann tröstet Papa sie. Und wenn Papa traurig ist, ist Mama für ihn da. Wir tragen deinen großen Bruder immer im Herzen, mit viel Liebe. Und wenn du ihn auch lieb hast, dann freuen wir uns. Er war der Erste, dann bist du gekommen, unser Zweiter, und für uns ist es ein ganz großes Geschenk, euch beide lieb zu haben.“
Genauso ist es auch möglich, jenen Menschen mit Achtung zu begegnen, die wir bisher missachtet haben, oder jene anzuerkennen, die wir lieber vergessen wollten. Für gewöhnlich steht es nicht in unserer Macht, vergangene Ereignisse zu ändern, aber wir können sehr wohl wählen, welche inneren Haltungen wir einnehmen wollen. Und es ist sicherlich der Mühe wert, das Experiment zu wagen und den Unterschied zu erfahren – an uns selbst und an unseren Kindern –, wenn es uns gelingt, von der Ablehnung zur Anerkennung zu kommen, vom Schweigen zum Gespräch, vom Vorwurf zum Verzeihen, vom Schmerz zur Liebe, von der Kritik zur Dankbarkeit.
Wir können uns diese inneren Bilder wie einen Film vorstellen, den wir auf eine große Leinwand projizieren, für uns selbst und für unsere Kinder. So als ob wir die alten Geschichten mit neuen Worten erzählten, die endlich auch das ausdrücken, was zuvor hinter der Stille nur zu erahnen war. Worte und Bilder, bei denen das Explizite und das Implizite übereinstimmen, bei denen Oberfläche und Tiefe zusammenpassen, bei denen die natürliche Ordnung in den Beziehungen zwischen Erwachsenen und Kindern wieder hergestellt wird. Und wie bei allen guten Geschichten kommt auch hier der Moment, da sie lebendig werden und uns mitnehmen auf die Reise zu neuen und überraschenden Orten...